|
ier möchte ich mich mit den Waffen des indischen
Tigers beschäftigen und der Kraft die dieser bei
der Jagd entwickelt als auch im allgemeinen besitzt.
Ich werde zunächst die Primärwaffe des Tigers,
sein Gebiss, genauer unter die Lupe nehmen. Um das zu
verstehen von dem ich später berichten werde sollten
wir uns zuerst mit den Benennungen vertraut machen die
in der Dentologie gebräuchlich sind. Hier eine
kleine Ausstellung: (siehe weiter unten)
Was die Schreibweise betrifft gilt die Regel, den jeweilig
gemeinten Zahn, wie oben beschrieben, abzukürzen
und mit dem Index seiner Position zu versehen. Sollte
ein Zahn im Oberkiefer gemeint sein so wird der Positionsindex
hochgestellt andernfalls tiefgestellt an die bisherige
Bezeichnung des Zahnes angehängt.
Doch nun zur Beschreibung des Tigergebisses. Der Ober-
und der Unterkiefer sind mit einem "Articulus cylindricus",
oder auch Walzengelenk genannt, miteinander verbunden.
Der Unterkiefer ist relativ lang und mit einem kräftigen
Kronenfortsatz (Processus coronoideus) ausgestattet.
Obwohl es im Gebiss des Tigers, als auch bei allen anderen
Felidae, zu gewissen genetischen Unregelmäßigkeiten
(charakteristisches fehlen von Zähnen
zum Beispiel) kommt, möchte ich jedoch auf
diese nicht näher eingehen.
Beginnen wir bei den wohl auffälligsten Zähnen,
den Caninae oder Eckzähnen. Sie können im
Durchschnitt eine Länge von etwa 70mm und mehr
(bis 90mm) erreichen. Dieses Maß bezieht sich
auf die Länge von der Zahnspitze bis zum Alveolenrand.
Mit Alveolenrand ist der Austrittspunkt des Zahns aus
dem Kiefernknochen gemeint, in den die Zähne eingebettet
sind und der auch als Zahnfächer bezeichnet wird.
Die sichtbare Länge ist etwas geringer, da Alveolenrand
und Zahnfleischrand natürlich nicht überein
stimmen.
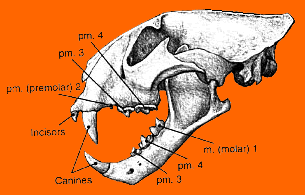  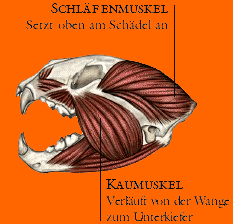
Die oberen Reißzähne sind konisch und leicht
nach innen gerichtet. Ihre Länge kann bei ausgewachsenen
Tigern 37mm und mehr betragen. Ein Beispiel für
solch einen Zahn ist der Pm4.die Paracon
die Größte und auch die Mittlere ist. Bei
anderen Großkatzen ist das Zahnschema sehr ähnlich.
Die rechte Abbildung zeigt die Ansatzflächen des
Muskeln und die Muskulatur selbst. Wie man an den sehr
großen Backenmuskeln sieht, kann ein Tiger einen
sehr hohen Zubeißdruck, im Bereich von mehreren
Tonnen, entwickeln.
Die Pendants zu den Reißzähnen des Oberkiefers
sind sowohl etwas kleiner als auch stärker nach
innen gebogen und erreichen Längen um 28mm. Diese
sind, ebenso wie die Reißzähne im Oberkiefer,
an den Seiten abgeflacht haben aber statt drei nur zwei
Spitzen, die Paraconid und Protoconid genannt werden.
Ein Bespiel für einen solchen Zahn wäre der
M1. Es muß noch ausdrücklicht
gesagt werden, daß die Reißzähne nicht
die Eckzähne sind, da dies eine relativ häufige
Verwechselung ist.
Das gesamte Zahnsystem des Kiefers arbeitet, umgangssprachlich
ausgedrückt, nach dem Brech-Scheren-Prinzip, daß
durch die enorm kräftige Kiefermuskulatur natürlich
unterstützt wird. Der Zubeißdruck den ein
erwachsener Tiger erreichen kann liegt im Bereich von
mehreren zehn Tonnen (punktuell). Diese Kraft reicht
aus um beispielsweise den Femur (Oberschenkelknochen)
eines Rindes zu zerbeißen.

Dies ist der Eckzahn eines mittelgroßen
Tigers.
Mit 7cm (Abb. 1:1) liegt seine Größe
gut im Mittelfeld, da sehr
große Exemplare die 9cm überschreiten. |
|
| dentologische
Fachbegriffe: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(die meisten Begriffe sind auch in der
Humanmedizin gebräuchlich)
- Vorbackenzahn = Prämolar (Pm)
- Backenzahn = Molar (M)
- Fang-/Eckzahn = Canini (Plural: Caninae)
- Schneidezahn = Inzisivus (Plural:
Inzisivae)
- Parastyl, Paracon, Metacon = Spitzen
von Zähnen (oben)
- Paraconid, Protoconid = Spitzen von
Zähnen (unten)
- Diastema = leerer Zwischenraum zweier
Zähne
Zahnformel des Tigers:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1.3.1
|
|
|
|
|
Zahnformel = |
=
30 Zähne |
|
|
3.1.2.1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- die Zahlformel gibt die Zähne
pro Kieferhälfte an, da die beiden
Hälften symmetrisch sind
- im Klartext: Im Oberkiefer gibt es
zwei mal drei Inzisivae, ein Canini,
ein Diastema, drei Prämolare und
einen Molar;
- im Klartext: Im Unterkiefer gibt es
zwei mal drei Inzisivae, ein Canini,
ein Diastema, zwei Prämolare und
einen Molar;
- das Diastema des Oberkiefers ist zwischen
den Inzisivae und den Caninae; das des
Unterkiefers zwischen Caninae und Prämolaren
Warum? Andernfalls könnte der Tiger
seinen Mund nicht schließen, da
die langen Eckzähne bei geschlossenem
Mund in diesen Diastema liegen
|
|
|
Wie das aller Raubtiere ist das Tigergebiss darauf
optimiert die Beute fest zu halten und nach dem Töten
Stücke aus dem Körper der Beute herauszureißen.
Zu erwähnen ist noch, daß Raubtiere ihre
Kiefer "nur" auf und ab und nicht seitwärts
bewegen können.
Auf den obigen Darstellung kann man sehr gut erkennen
wie das Tigergebiss wirkt und wie es aufgebaut ist.
Wie schon erwähnt ist es nicht dafür ausgelegt
Knochen durch Scherung zu brechen, sondern tief in die
Beute einzudringen und große Stücke aus dem
Körper zu reißen. Auf der rechten Abbildung
kann man auch sehr schön erkennen wie breit die
Zunge im Vergleich zum Abstand der unteren Caninae ist.
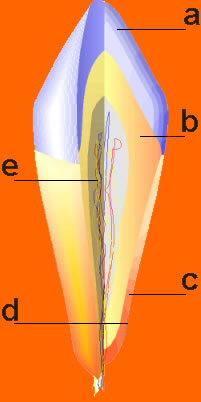
a=Zahnschmelz; b=Dentin; c=Zement; d=Wuzelhaut,
e=Pulpa |
Der Aufbau der Zähne eines Tigers haben
den gleichen Aufbau wie die Zähne des Menschen
und aller anderen Säugetiere. Dies hat
natürlich auch zu Folge, daß auch
Tiger an den gleichen Zahnkrankheiten leiden
wie wir. Dies wären Karies oder Parodontitis.
Nachfolgend möchte ich deswegen gerne auf
den Aufbau der Zähne im Allgemienen kuz
eingehen.
Der Zahn ,lat. Dens, ist ein Einzelsegment
des Gebisses eines Wirbeltieres. Er wird in
drei Bereiche, die sichtbare Krone, die Wurzel
und der dazwischeliegende Zahnhals, unterteilt.
Mit den Wurzeln lagert der Zahn im Alveolarfortsatz
(Zahnfach) des Kiefers und wird über das
Periodontium (Wurzelhaut) mit dem Knochen befestigt.
Im Innern des Zahnes nimmt ein Hohlraum die
Pulpa (Zahnmark) auf. Diese besteht aus Gefäßen
und Nerven, die an den Wurzelspitzen austreten.
Der größte Teil des Zahnes wird vom
Dentin (Zahnbein) gebildet, das zu einem Viertel
bis Drittel aus lebender Substanz besteht. Bei
Reptilien und Sägetieren ist die Krone
vom Zahnschmelz überzogen. Dieser besteht
fast ausschließlich aus anorganischer
Substanz und bekommt durch Fluorverbindungen
eine außerordentliche Härte. Die
Zahnwurzel ist von Knochensubstanz, dem Zement
überzogen. Mit Ausnahme der Säugetiere,
werden bei allen Wirbeltieren die Zähne
ständig ersetzt. Dieser dauernde Zahnwechsel
nennt sich Polyphyodontie. Wie beim Tiger, findet
bei fast allen Säugetieren lediglich einmal
im Leben ein Zahnwechsel statt, die sog. Dyphyodontie.
Nach Stellung und Aufgabe der Zähne unterscheiden
sich diese auch meist in ihrer Form, wie oben
beschrieben.
 Hier
ist einer der wohl schmerzhaftesten Verletungen
an der ein Tiger oder anderes Säugetier
(vor allem Carnivoren) leiden können. Der
von hier gesehene rechte untere Fangzahn ist
abgesplittert (gebrochen) und man kann sogar
die Nerven sehen. Bei einem Tiger wird eine
solche Verletung wie beim Menschen behandelt,
der Zahn wird wieder mit Zement oder anderen
Stoffen aufgebaut oder muß gezogen und
gegebenenfalls ersetz werden. Hier
ist einer der wohl schmerzhaftesten Verletungen
an der ein Tiger oder anderes Säugetier
(vor allem Carnivoren) leiden können. Der
von hier gesehene rechte untere Fangzahn ist
abgesplittert (gebrochen) und man kann sogar
die Nerven sehen. Bei einem Tiger wird eine
solche Verletung wie beim Menschen behandelt,
der Zahn wird wieder mit Zement oder anderen
Stoffen aufgebaut oder muß gezogen und
gegebenenfalls ersetz werden.
|
Der Gebiss des Tigers weist auch
hin und wieder interessante Abweichung von der normalen
Zahnformal auf. Meist sind diese Abewichungen auf den
Oberkiefer beschränkt, können jedoch in einzelen
Fällen auch im Unterkiefer vor kommen. Das Gebiss
des Tigers hat sich bedingt durch eine evolutionäre
Entwicklung immer mehr spezialisiert. Der erste Molar
im Oberkiefer (M1) fehlt aus statistischer
Sicht recht häufig. Obwohl dieser Zahn recht klein
sein sollte, kann es vorkommen, daß wenn er vorhanden
ist auch durchaus von enormer Größe (im Gegensatz
um normalen Molar) ist. Aus stammesgeschichtlicher Sicht
der Felidae hat dieser Zahn aber kaum funktionelle Bedeutung
im Kiefer und wurde wohl auch deswegen seit Jahrhunderten
immer mehr zurückgebildet. Es scheint sich also
um einen Atavismus zu handeln, da nach dem Dollo'schen
Gesetz keine Entwicklung zu breits schon einmal ausselektiertem
geschieht, wo bei dieses Gesetz heute immer mehr in
Frage gestellt wird. Ebenso wie der M1 kommt
es vor das der erste Prämolor des Oberkiefers (Pm2)
fehlt. Vom indischen Tiger ist ein sehr seltes Phänomen
bekannt. daß den Unterkiefer betrifft. Hinter
dem Reißzahn (M1) existiert dann eine
kleine Zähnhöhle die auf einen überzähligen
Molar (M2) hinweisen und symmetrisch im Unterkiefer
(also hinter beiden Reißzähnen) vorhanden
sind. Dieses Phänomen wurde vom deutschen Professor
Max Hilzheimer 1905 beim indischen Tiger beschrieben.
Es ist anzunehmen, daß andere Tigerarten ebenfalls
diese Eigenheit ausprägen - stammesgeschichtlich
bedingt.
Weitere Darstellungen des Tigergebisses und des Schädels
findet man in den jeweilen Bereichen hier in der Anatomie
Rubrik.Auf jeden Fall kann ich noch die Sektion Tigerskelett
(oben auswählen) empfehlen, da hier auch weitere
Zusammenhänge dargestellt werden.
Als letztes zu diesem Thema möchte ich den Unterschied
zwischen den Geschlechtern ansprechen, denn meine bisherigen
Ausführen bezogen sich nur auf männliche Tiger.
Im Großen und Ganzen gilt für die Tigerinnen
das Selbe wie für die Tiger, mit Einschränkung
bei den Dimensionen. Man kann allgemein von einer Reduktion
aller Maße um bis 20% bei den Tigerinnen sprechen.
Ich möchte es mir hier allerdings sparen die Abmessungen
explizit anzugeben.
Falls es noch weitere Fragen gibt, kann
man mir hier einfach eine EMail schreiben: 
|
